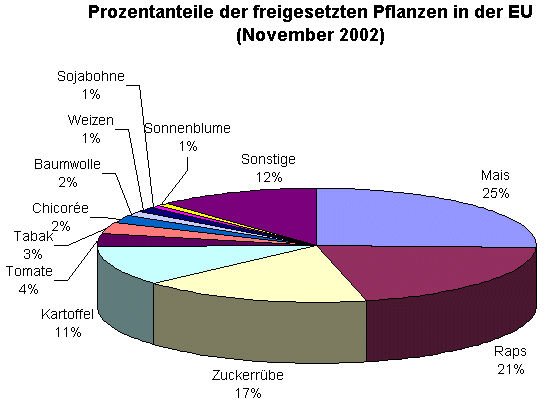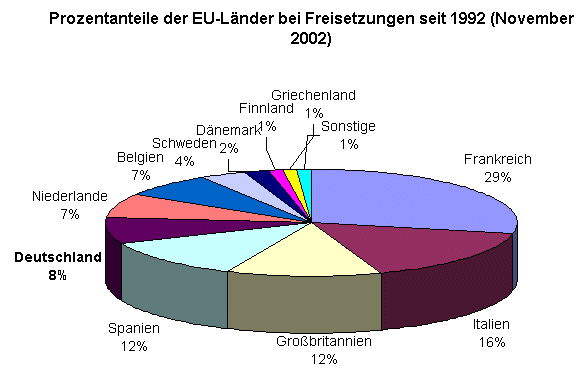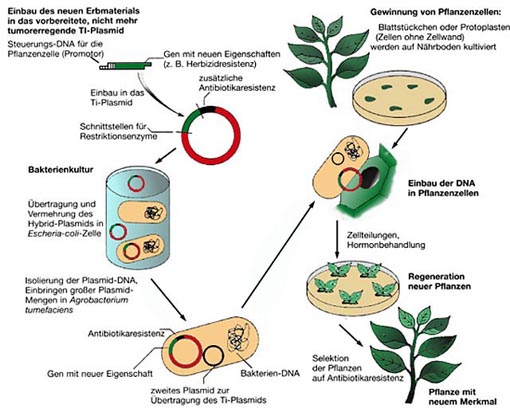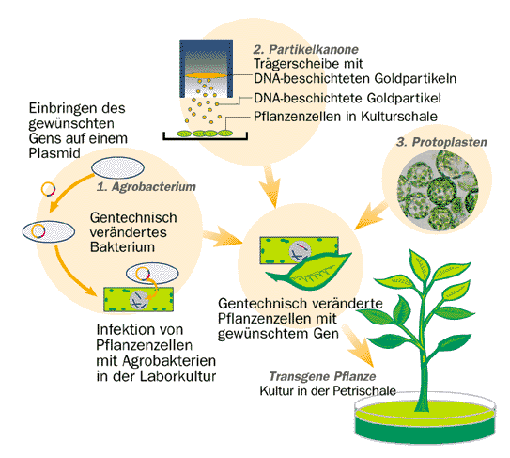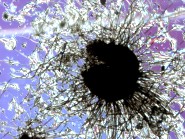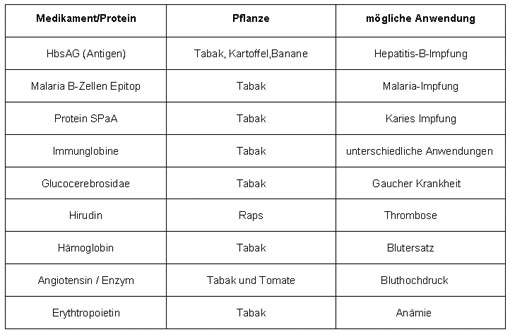|
Gentechnik und Tabak
Ein Überblick über
den derzeitigen Forschungsstand
Joachim Acker
Es gibt wohl kaum ein Gebiet in der heutigen Wissenschaft
über das so kontrovers diskutiert wird wie die Gentechnik.
Hier treffen ethische, medizinische, philosophische und theologische
für und wider Argumentationen mit großer Heftigkeit
aufeinander, teils sachlich erörtert, aber auch mit großer
Polemik vorgetragen und dabei selten frei von Emotionen. Denken
wir nur an die erbittert geführten Auseinandersetzungen
über das Klonen von Tieren. Im folgenden Artikel wollen
wir uns behutsam diesem Thema nähern
Eine kleine Einführung in ein schwieriges Thema
Gene sind die Träger des Erbgutes die in den Chromosomen
im Zellkern liegen und in ihrer Gesamtheit (Genom) das Erbgut
von Pflanze, Tier und Mensch bestimmen. Das Gen ist ein einzelner
Abschnitt auf einem viele Gene umfassenden Molekül, der
Desoxyribonukleinsäure (Abkürzung DNS, heute häufig
DNA genannt von englisch deoxyribonucleic acid).
Die DNS besteht aus einem langen Doppelstrang, in dem sich Zuckermoleküle
(Desoxyribose) und Phosphatreste abwechseln und der durch quer
stehende Basenpaare zusammengehalten wird. Die Abfolge der Basenpaare
(Basensequenz) enthält die Erbinformationen die für
die Entwicklung notwendig sind. Die einzelnen Basen wirken dabei
wie die Buchstaben eines Alphabets, aus der Abfolge mehrerer
Basen ergibt sich dann ein Sinn. Es ist im Grunde vergleichbar
mit einem Wort, dass sich ja auch aus der logischen Folge mehrerer
Buchstaben ergibt.
"Ein Gen enthält die genetische Information für
die Bildung einer jeweils spezifischen Polypeptidkette, so z.B.
für ein Struktureiweiß oder ein Enzym. Dadurch steuern
die Gene die Stoffwechselvorgänge der Zellen in den Geweben
und Organen. Sie steuern damit Entwicklung und Wachstum und alle
Lebensvorgänge eines Menschen."
Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG
Aus was besteht nun ein Gen? Um es mir etwas leichter zu machen
zitiere ich wiederum aus dem Lexikon:
"Die DNA ist ein fadenförmiges Molekül,
das aus zwei Ketten besteht. Die Kettenÿý auch Stränge
(englisch: strand) genanntÿý bestehen aus sich wiederholenden
Einzelbausteinen, den Nukleotiden, die über kovalente Bindungen
(Phosphorsäurediesterbindungen) miteinander verknüpft
sind. Die Nukleotide bestehen wiederum aus drei Teilen: einer
Phosphorsäure- beziehungsweise der Phosphatgruppe, einem
Zuckermolekül (der 2'-Desoxyribose) und einer Nukleobase.
In der DNA gibt es vier verschiedene Nukleobasen: Adenin, Guanin,
Cytosin, Thymin. In der RNA (Ribonukleinsäure) steht Uracil
an Stelle von Thymin. Die Nukleobasen sind mit dem Zuckermolekül
verbunden und bilden ein Nukleosid."
Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG
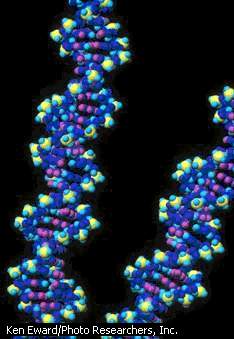 Bild 1: DNA Bild 1: DNA
Der Beweis dass die DNS das Trägermaterial für die
Gene ist gelang im Jahre 1944 den Wissenschaftlern Theodore O.
Avery und seinen Mitarbeitern John J.ÿR. Macleod und M.
McCarty. Ihre Forschungen fußten allerdings auf den schon
16 Jahre früher gemachten Untersuchungen von Frederick Griffith.
"Griffith hatte herausgefunden, dass bestimmte (erbliche)
Eigenschaften von abgetöteten Bakterien auf lebende Bakterien
übergehen können. Er konnte aber nicht beweisen, welche
biologische Substanz dabei von dem getöteten Bakterienstamm
auf den lebenden Stamm übertragen wird. Avery, Macleod und
McCarty haben die Experimente von Griffith wiederholt, aber anstelle
der abgetöteten Bakterien die aus den Bakterien isolierte
DNA benutzt. Die gereinigte DNA zeigte den gleichen Effekt wie
die hitzegetöteten Bakterien. Damit war klar, dass die Desoxyribonukleinsäure
das Trägermaterial der Gene ist. Seitdem steht die DNA im
Mittelpunkt aller genetischen Forschungen. Nach dieser Entdeckung
hat es immerhin noch fast 10 Jahre gedauert, bis die Struktur
der DNA im Jahre 1953 durch James Watson und Francis Crick aufgeklärt
wurde.
Weitere 10 Jahre hat es gedauert, bis das Geheimnis des genetischen
Codes durch Marshall Warren Nirenberg und Har Gobind Khorana
gelüftet wurde. Heute wissen wir, dass die DNA die Erbsubstanz
aller Organismen ist."
Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG
Wird ein Gen, d.h. die DNS verändert (durch chemische Einflüsse
oder durch Radioaktivität (um nur zwei Möglichkeiten
zu nennen) dann kann dies einen Erbsprung, eine Mutation, erzeugen,
das kann in der Natur spontan geschehen. Ein gutes Beispiel dafür
ist der Burley Tabak, der einer solchen Mutation entstammt. Im
Jahre 1864 wurden auf dem Feld eines Tabakpflanzers in Ohio/USA
mutierte Tabakpflanzen festgestellt. Es handelte sich um eine
ganz spezielle Mutation, die einen Chlorophyllmangel erzeugte.
Bedingt durch diesen Mangel zeigten sich aber dann doch verschiedene
negative Aspekte: geringere Widerstandsfähigkeit gegenüber
Krankheiten, Reaktionen auf extreme Witterungseinflüsse
und ein verlangsamtes Wachstum.Dennoch wurde diese Pflanze, der
man den Namen Burley gab, ein sehr wichtiger Basistabak für
Mixtures mit vornehmlich amerikanischen Charakter, wir finden
Burleyanteile aber auch in mancherlei dänischen Mixtures.
Die Genetik ist die Wissenschaft die sich mit der Erforschung
und Funktion der Gene beschäftigt, begründet wurde
sie durch den Augustinermönch Gregor Mendel (1822 - 1884)
der seine Forschungen und Erkenntnisse auf dem Gebiet der Vererbungslehre
erstmals 1865/66 in seiner Schrift >Versuche über Pflanzenhybriden<
der Öffentlichkeit vorstellte.
Von den Anfängen Mendels bis zum heutigen Stand der Wissenschaft
war es dann freilich noch ein langer, steiniger und mühsamer
Weg den wir hier nicht nachvollziehen wollen.
Heute greift die aus der Genetik entstandene Gentechnik immer
mehr und nachhaltiger in unser Leben ein.
Die Gentechnik beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit
den Methoden durch die Gene und ihre Regulatoren analysiert,
isoliert, verändert und wieder in Organismen eingebaut werden.
Solche >Umbauten< wurden erst ermöglicht als Wissenschaftler
die Restriktionsenzyme entdeckten. Diese Enzyme können aus
einem DNS Strang genau festgelegte und definierte Teilstücke
herausschneiden die dann Mittels der Ligasen (ebenfalls ein Enzym)
wieder an einer anderen Stelle eingefügt werden. Andere
Methoden bedienen sich zum Beispiel der Elektroportation (durch
elektrische Impulse wird die Biomembran kurzfristig erhöht);
oder dem einbringen von DNS durch Mikroinjektion; durch Partikelbeschuss
mittels einer sogenannten Gen-Kanone; Ultraschall wird ebenfalls
verwendet.
Das dies alles eine höchst komplizierte Angelegenheit ist
liegt auf der Hand, es ausführlicher darzustellen würde
den Rahmen dieses Artikel sprengen.
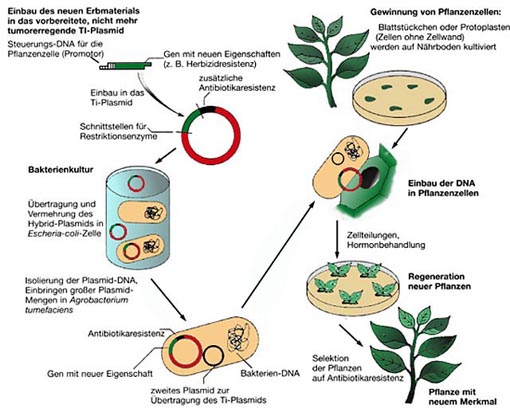
Bild 2
Pflanzen oder Tiere deren Erbanlagen ein Gen enthalten das
aus einem fremden Organismus entnommen ist, werden transgene
Organismen oder auch >genetisch veränderte Organismen<
(GVO) genannt.
Die Gentechnik ermöglicht es also, ganz gezielt einzelne
Gene aus einem Organismus zu entfernen und durch ein anderes
Gen, das bessere Eigenschaften aufweist, zu ersetzen. Diese neuen
Möglichkeiten machte sich schon sehr früh die Landwirtschaft
zu nutze. Bereits 1983 gelang die erste Züchtung einer transgenen
Pflanze, es war (wie könnte es auch anders sein) Tabak.
20 Jahre später gibt es von fast allen Kulturpflanzen gentechnisch
veränderte Sorten. Dazu gehören neben Mais, Soja, Raps,
Baumwolle, Kartoffeln auch der Tabak.
Um noch ein Beispiel zu nennen: 1993/94 gelang es amerikanischen
Wissenschaftlern eine genveränderte Tomate, die >Anti-
Matsch- Tomate< (Flavr Savr = englisch: Flavor saver = Geschmacksretter,
bewahrer) herzustellen. Bei dieser Tomate wurde das Gen für
das Enzym Polygalacturonidase das für das Reifen und damit
auch für das Weichwerden der Tomate verantwortlich ist ausgeschaltet.
Diese transgenen Tomaten hielten von nun an durch die gentechnisch
erzeugte Reifeverzögerung die erreicht wurde länger
frisch.
Genveränderungen an der Tabakpflanze
Wenn im folgenden von Tabak die Rede ist dann wird immer Nicotiana
tabacum gemeint sein.
"Tabak ist das pflanzliche Gegenstück zur weißen
Labormaus", mit diesen Worten kommentiert Dr. Charles Arntzen
vom Boyce Thompson Institute for Plant Research im Norden des
Bundesstaates New York die Bedeutung des Tabaks für die
Gentechnik.
Quelle: http://www.archiv.hoechst.de/deutsch/publikationen/future/ernaehr/art6.html
Virenresistenter Tabak
Gegen Viruserkrankungen bei Pflanzen, insbesondere dem Tabak,
stehen keine geeigneten chemischen Bekämpfungsmaßnahmen
zur Verfügung. Es können zwar Insektizide gegen die
viren-übertragenden Insekten (Vektoren) eingesetzt werden,
aber dies geschieht dann immer mit einem gewissen Risiko gegenüber
anderen Lebewesen, die dabei selber vernichtet werden.
Eine gefürchtete Virenerkrankung der Tabakpflanze ist der
Tabak Mosaik Virus (TMV, mehr darüber in dem Artikel: Die
Krankheiten der Tabakpflanze). 1986 gelang es Wissenschaftlern
erstmals bei einer Tabakpflanze auf gentechnischem Wege eine
Virusresistenz zu züchten. Dabei wurde die 1929 erstmals
bei Tabakpflanzen beobachtete >Präimmunität<
ausgenutzt. Präimmunität bedeutet hier: Tabakpflanzen
die mit einem nur sehr schwach wirkendem krankheitserregenden
Stamm des TMV befallen waren zeigten bei einem späteren
Befall stärkerer Viren eine Resistenz dagegen. Wir können
dieses Phänomen mit einer Schutzimpfung beim Menschen gleichstellen
bzw. vergleichen. Die Ursache für diese Präimmunität
sind die in den Pflanzenzellen vorhandenen Hüllproteine
der Viren die zu nutze gemacht werden (Hüllproteinschutz,
coat protein mediated resistance).
"Dazu muss zunächst die Erbinformation für
das Hüllprotein des entsprechenden Virus vermehrt werden.
Besteht die Erbinformation des Virus aus RNA (Anmerkung 1) ,
wird im ersten Schritt die isolierte virale Hüllprotein-RNA
mit dem Enzym Reverse Transkriptase in DNA umgeschrieben und
dann durch Klonierung vermehrt, um genügend Ausgangsmaterial
zu erhalten. Die Hüllprotein-DNA wird dann mit einem geeigneten
pflanzlichen Promotor in das Ti-Plasmid des Agrobacterium tumefaciens
eingebaut und mittels des Agrobakterien-Systems auf die Pflanze
(Protoplasten) übertragen. Die herangezogenen Pflanzen produzieren
in allen Zellen Hüllproteine des Virus und sind damit resistent
gegen eine Infektion. Der molekulare Mechanismus der Resistenz
ist noch nicht genau aufgeklärt."
Quelle: http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-11.htm
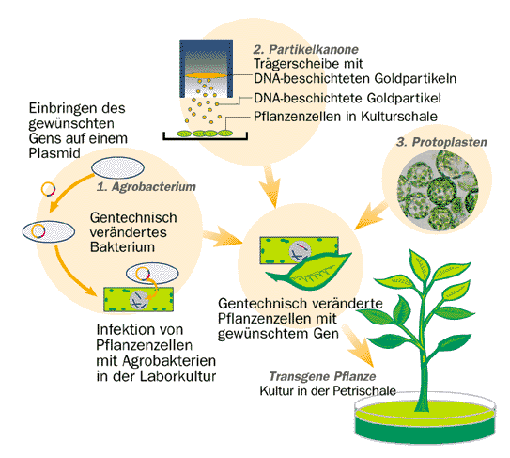
Bild 3
In diesem Zitat wird das Agrobakterien-System genannt, darauf
wollen wir für einen Moment unser Augenmerk richten. Es
ist ein ausgesprochener Glücksfall für die Gentechnologie
dass in dem Bakterium >Agrobacterium tumefaciens< ein natürliches
Genübertragungssystem vorhanden ist. Agrobacterium befällt
Pflanzen und regt sie zur Tumorbildung an (tumefacies = tumorbildend).
"Bei der Infektion einer Pflanzenzelle mit dem Bakterium
wird ein kleiner DNA-Abschnitt, das Ti-Plasmid, von der Bakterienzelle
in die Pflanzenzelle eingeschleust. Ein Teil dieser bakteriellen
DNA findet den Weg in die Chromosomen der Pflanzenzelle und wird
dort eingebaut. Das Bakterium manipuliert genetisch die Pflanzenzelle,
die dadurch zum Tumorwachstum angeregt wird."
Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG
Dieses Transfersystem nützen die Wissenschaftler, indem
sie die Bakterien gentechnisch verändern, dann wird das
zu übertragende Gen in das Ti-Plasmid eingebaut und das
Bakterium übernimmt den Transfer zu den Pflanzenchromosomen.
Neben der Hüllprotein Methode gibt es noch andere Möglichkeiten
virenresistente Pflanzen durch Genmanipulationen zu erzeugen:
Resistenz vermittelt durch RNA abhängige RNA-Polymerase;
Schutz durch Bildung defekter Transportproteine;
Resistenz vermittelt durch Satelliten-RNA;
Resistenz vermittelt durch antivirale Proteine.
Über die Resistenz durch antivirale Proteine schreibt
das Deutsche Bundesumweltamt in den:
Fachinformation zum Thema Biologische Sicherheit/Gentechnik vom
17.09. 2000:
"Während mit Ribozymen bisher kein genügender
Schutz von Pflanzen erreicht werden konnte, waren Tabak und Kartoffeln,
die Ribosomen-inaktivierende Proteine aus der Kermesbeere (Phytolacca
americana) produzierten, resistent gegen verschiedene Viren.
Werden die Ribosomen gehemmt, die für die Proteinherstellung
in der Zelle zuständig sind, so stirbt die Zelle ab. Damit
wird auch die Vermehrung des Virus unterbunden. Antivirale Proteine
weisen ein breites Wirkspektrum auf, jedoch waren Pflanzen, die
hohe Konzentrationen von Ribosomen-inaktivierenden Proteinen
bildeten, vom Aussehen nicht normal."

Bild 4: Kermesbeere
Das erste Land das virenresistenten Tabak anbaute und in den
Handel brachte war China zu Beginn der 90er Jahre im vorigen
Jahrhundert, wenig später erfolgte dann die Vermarktung
virenresistenter Tomaten.
Schädlingsresistenter Tabak
Das massenhafte Auftreten von Insekten stellt für den
Tabakpflanzer (und die gesamte Landwirtschaft) eine große
Gefahr dar. Insektizide vernichten zwar die Schädlinge,
können aber auch gleichzeitig zum Nachteil für andere
Insekten werden, die sich von den zu bekämpfenden Plagegeistern
ernähren.
Die Gentechnik verwendet gegen blattsaftsaugende Insekten (Homoptera
- (Anmerkung 2) ein für Insekten schädliches
Protein, das d-Endotoxin, des im Erdboden lebenden Bakteriums
Bacillus thuringiensis (B.t.).
Aus diesem toxischen Protein wird ein Gen entnommen und in das
pfllanzliche Genom der zu schützenden Pflanze (mittels dem
schon weiter oben genannten Agrobacterium tumefaciens) eingebracht
und zerstört durch seine toxische Wirkung den Darm der Insekten.
Die Proteine d-Endotoxine werden in verschiedene Klassen
Cry1 aktiv gegen Schmetterlinge (und Käfer), Molekulargewicht:
130 kDa
Cry2 aktiv gegen Schmetterlinge (und Zweiflügler), 70 kDa
Cry3 aktiv gegen Käfer, 70 kDa
Cry4 aktiv gegen Zweiflügler, 130 kDa
Cyt unspezifisches Cytotoxin, 30 kDa (nur in B.t. subsp. israliensis)
und diese jeweils in Unterklassen eingeteilt.
Tabak (und auch die Tomate) wurden 1987 erstmals mit Cry1A Genen
transformiert, beide Pflanzen zeigten in der Folge eine signifikante
Toleranz gegen die schädliche Schmetterlingsraupe.
Als insektizides Spritzmittel war das B.t. Toxin schon viele
Jahrzehnte wichtiger Bestandteil des Landbaus und verursachte
enorme Kosten, die durch den Einsatz transgener Tabaksorten von
nun an deutlich verringert werden können.
Wissenschaftler fanden aber heraus dass sich gegen das B.t.
Toxin eine Resistenz entwickeln konnte:
"Eines der bekanntesten Gene, das in ganz verschiedene
Nutzpflanzen eingebaut wurde, ist das sogenannte Bt-Gen, ein
Gen das aus dem Bakterium Bacillus thuringiensis (Bt) stammt
und die Information für die Produktion einer Reihe sich
ähnelnder Insektengifte trägt. Gegen diese sogenannten
Bt-Toxine, die in den transgen veränderten Nutzpflanzen
ständig produziert werden und somit permanent während
der Vegetationsperiode vorhanden sind, können sich Resistenzen
entwickeln.
Nun gelang es verschiedenen Wissenschaftlern, einige neue grundlegende
Erkenntnisse über Bt-Resistenzen zu gewinnen. Zwei Forschergruppen,
eine um Linda Gahan von der Clemson Universität in South
Carolina und David Heckel von der Universität Melbourne
in Australia und die andere um Raffi Aroian von der University
of California in San Diego, haben die ersten Gene, die für
Bt-Resistenz verantwortlich sind, identifiziert. Einen praktischen
Nutzen dieser Untersuchungen könnte die Entwicklung eines
einfachen DNA-Tests sein, mit dem geprüft werden kann, ob
bei einem akutem Insektenbefall schon Resistenzen vorhanden sind.
Dies könnte den Landwirten helfen, Resistenzen so rechtzeitig
festzustellen, dass der weitere Anbau von Bt-Nutzpflanzen eingestellt
werden und eine Zeitlang wieder auf chemische Insektizide zurückgegriffen
werden kann.
Die Bt-Gifte binden an Zellen im Darm der Insekten, wodurch die
Zellen zerstört werden. Eine Veränderung im Erbgut,
die mit sich bringt, dass Bt-Gifte nicht mehr gebunden werden,
könnte somit entweder direkt oder indirekt eine Bt-Resistenz
bewirken. Beide Forschungsgruppen fanden unabhängig voneinander
verschiedene Gene, die bei einer Veränderung in ihrer Basensequenz,
eine Bt-Resistenz verursachten. Die Proteine, für die diese
Gene codierten, besitzen die Eigenschaft Bt zu binden. Da sie
nicht mehr produziert wurden, fand keine Bindung von Bt mehr
statt und das Gift blieb wirkungslos." Quelle: Gentechnik
Nachrichten 26
Zu alle dem hat sich dann noch herausgestellt, dass Nützlinge
(die grüne Florfliege z.B.) die B.t. Toxin geschädigte
Insekten fraßen, ebenfalls erkrankten. Bei Feldversuchen
in der Schweiz wurde erkannt, dass die Wirtslarven, die sich
von transgenen B.t. Tabakblättern ernährten, deutlich
weniger attraktiv als Eiablage für die Schlupfwespen (Campoletis
sonorensis) waren, d.h. Schlupfwespen mieden diese Larven.
Bei vergleichenden Untersuchungen an transgenen und normalen
Tabak konnte außerdem festgestellt werden, dass die Larven
der jungen Tabakeule (Heliothis virescens) an den transgenen
Tabakblättern weniger fraßen als an den unbehandelten.
Diese reduzierte Fraßleistung wurde auch bei der Schlupfwespe
festgestellt, sie war an dem transgenem Tabak weniger anzutreffen
als beim unverändertem Tabak. Als Grund wird nicht nur die
toxische Wirkung angenommen, sondern auch eine gewisse Unattraktivität
des transgenen Tabaks. Er war für die Tabakeule schlicht
und einfach nicht mehr anziehend genug.
"Das könnte mit folgendem zusammenhängen:
Wird eine Pflanze von einem Herbivoren attackiert, bildet sie
flüchtige Sekundärstoffe. Diese Stoffe wiederum locken
Parasitoide an, die dann den Herbivoren befallen. Da Pflanzen
erst bei einer gewissen Fraßintensität der Herbivoren
flüchtige Stoffe bilden, kann es für die Parasitoide
schwierig werden, in einem transgenen Feld ihre Wirte zu finden."
Quelle: http://www.biogene.org/e/themen/biotech/wwf.htm
Um pflanzensaftsaugende Insekten abzuwehren oder zu vernichten
entwickelte die Gentechnik verschiedene transgene Tabaksorten
die ein zusätzliches Gen für die Produktion von Lektinen
enthielten.
Lektine (Anmerkung 3) werden als Abwehrstoffe gegenüber
Homoptera die gegen das B.t. Toxin unempfindlich sind angesehen.
Allerdings können sich solche Lektine wiederum negativ auf
nützliche Insektenarten auswirken. So erweist sich die Gentechnik
immer wieder als eine Art zweischneidiges Schwert: Auf der einen
Seite kann sie zum Nutzen sein, auf der anderen Seite offenbart
sie ihre schadensbringende Seite.
Pilzresistenter Tabak
Die Pilzerkrankungen der Tabakpflanzen (Grauschimmel, Blauschimmel
und Mehltau) sind ebenfalls Ziel der gentechnischen Forschung.
Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Stilbenen. Das sind
natürlich vorkommende sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe
(Polyphenole) Anmerkung 4, die antibakterielle und fungizide
Eigenschaften aufweisen. Die Pflanze bildet diese Stoffe, sogenannte
Phytoalexine, bei einem Befall zur Abwehr von Schädlingen
wie z.B. Pilzen, Bakterien und Viren. Sie entstehen also infolge
einer gewissen Stress-Situation der Pflanze, als Selbstverteidigung
gewissermaßen.
Stilbene vom Typ Resveratrol sind am weitesten verbreitet, sie
finden wir in den Weinreben, Kiefern, in den Erdnüssen und
im Rhabarber. Es wurden von Wissenschaftlern Gene von Resveratrol
aus Weinreben extrahiert und in die Gene der Tabakpflanze (und
der Tomate) eingefügt die vor diesem Eingriff selber nicht
in der Lage waren Stilbenen zu bilden. Durch diesen Eingriff
konnte teilweise eine erhöhte Pilzresistenz der genannten
Pflanzen erzeugt werden und die neuen Wirtspflanzen erzeugten
nun selber Stilbenen die in andere Pflanzen transferiert werden
können.
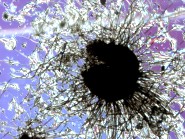
Bild 5: Schimmelpilz Alternaria
"Der Transfer von Stilbensynthase-Genen könnte
diesen wirksamen Resistenzmechanismus in einer Vielzahl von Kulturpflanzenarten
zukünftig nutzbar machen. Man muss aber noch überprüfen,
ob von den Stilbenen auch in höheren Konzentrationen keinerlei
toxische Gefahren oder die Erbinformation schädigende Wirkungen
ausgehen."
Quelle: http://www.gsf.de/IU/index.html
Bei solchen gentechnischen Manipulationen an Pflanzenzellen
kann es dann allerdings zu gewissen Nebeneffekten kommen. Eine
Überproduktion von Stilbenen der Weinrebe führte im
transgenen Tabak zu einer veränderten Blütenfarbe (weiße
statt rote) und männlicher Sterilität.
Eine andere Möglichkeit, pilzresistenten Tabak zu züchten,
ist das Transferieren von Genen zur Glucanasen - oder Chitinasen-Synthese.
Das Chitinasen Enzym regelt (ebenso wie das Glucanasen Enzym)
die Bildung von Chitin, Chitin ist für den Aufbau der Zellwände
einiger Pilzarten verantwortlich. Die für solch einen Transfer
benötigten Gene werden dem Bodenbakterium Serratia marcescens
entnommen. Durch diese Methode haben Wissenschaftler Tabakpflanzen
erzeugen können die eine erhöhte Chitinase Aktivität
zeigten und gegen Schimmelpilze vom Typ Alternaria longipes resistent
waren.
Herbizidresistenter Tabak
Ein mit Wildkräutern (ein Wort das Heute oftmals anstelle
von Unkraut verwendet wird) zugewuchertes Tabakfeld lässt
möglicherweise das Herz eines Naturfreundes erbeben, der
Tabakpflanzer wird es aber nicht gerne sehen. Wildkräuter:
z.B. die Quecke (Agropyron repens), Acker-Winde (Convolvulus
arvensis), Tabakwürger (Orobanche ramosa, die ästige
Sommerwurz) und andere mehr, treten gegenüber den Nutzpflanzen
als Nahrungskonkurrenten auf und können durchaus den Ertrag
und die Qualität der angebauten Pflanze schmälern.
Um es nicht soweit kommen zu lassen wurde in früheren Jahren
fleißig und ausdauernd gehackt und gejätet. Das Aufkommen
der Herbizide war für die Landwirte ein Segen und eine ernorme
Arbeitserleichterung. Heute sind über 800 verschiedene Herbizide
mit den unterschiedlichsten Wirkstoffen in Gebrauch und werden
je nach Anforderung und Bedürfnis verwendet. Herbizide haben
allerdings einen entscheidenden Nachteil: Sie können die
Nutzpflanze ebenfalls schädigen, sogar vernichten.
Um diese Gefahr auszuschalten entwickelten Gentechniker im Laufe
der Jahre Abwehrmechanismen die eine Kulturpflanze vor dem verwendeten
Herbizid in ausreichenden Maße schützte. So z.B. die
französische Firma Seita (Gauloises) die 1994 für eine
herbizidresistente Tabaksorte die EG Zulassung erhielt. Anmerkung
5
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe gentechnischer Präparate
mit verschiedenen Wirkstoffen (Sulfonylharnstoff, 2,4 D, Bromoxynil,
Glufosinat-Ammonium und Glyphosat) die eine Pflanze gegen das
angewendete Herbizid resistent machten, zwei davon wollen wir
etwas näher betrachten.
Der Wirkstoff Glyphosat ist Hauptbestandteil im nicht-selektiven
Herbizid Roundup (Handelsname), es wird von allen grünen
Pflanzenteilen aufgenommen, verteilt und ist anschließend
überall in der Pflanze wirksam. Glyphosat hemmt ein Enzym
des pflanzlichen Stoffwechsels - die lebenswichtige EPSP-Synthase
(Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat-Synthase). Dieses Enzym ist unentbehrlich
für den pflanzlichen Stoffwechsel denn es regelt die Herstellung
aromatischer Aminosäuren, die Bausteine der Eiweiße.
Wird dieser Stoffwechsel unterbrochen stirbt die Pflanze ab.
Die Herbizidresistenz wird nun dadurch erreicht dass ein Gen
für das Enzym CP4 EPSP-Synthase (das sich strukturell vom
EPSP Enzym unterscheidet) aus dem schon weiter oben erwähnten
Bakterium Agrobacterium tumefacies entnommen und in die Pflanze
transferiert wird, sie ist nun gegenüber dem Wirkstoff Glyphosat
resistent.
Glufosinat-Ammonium ist der Wirkstoff der Herbizide Basta
und Liberty (Handelsnamen) die seit vielen Jahren als nicht selektive
Mittel gegen die Wildkräuterbekämpfung eingesetzt werden.
Glufosinat wirkt in der Pflanze durch die Hemmung der Glutamin-Synthase.
Dadurch wird das Zellgift Ammoniak (es entsteht durch die Nitrat-Reduktion)
nicht mehr abgebaut und die Pflanze stirbt innerhalb weniger
Tage ab.
Die Resistenz gegenüber Glufosinat wird nun mit Hilfe des
im Boden lebenden Pilzes Streptomyces viridochromogenes erreicht.
Streptomyces produzieren das toxische Enzym Phosphinotrycin (PT)
mit dessen Hilfe sie das Wachstum artfremder Mitkonkurrenten
hemmen können. Wird Phosphinotrycin von einer Pflanze aufgenommen
kommt es zu einem Anstieg des Ammoniaks und die Pflanze stirbt
ab. Um sich selber vor diesem Gift zu schützen besitzt Streptomyces
ein Enzym namens Phosphinotrycinacetyltransferase, kurz PAT Enzym,
genannt, dieses Enzym ist außerdem noch dominant vererbbar.
Mit Hilfe des PAT wird das giftige PT inaktiv gemacht.
Wissenschaftlern ist es gelungen das Gen für das PAT Enzym
zu isolieren und auf Nutzpflanzen, darunter auch den Tabak, zu
übertragen. Die transgenen Pflanzen können nun das
für sie wichtige Enzym PAT selber herstellen und sind gegenüber
dem Herbizidwirkstoff Glufosinat-Ammonium fortan resistent.
Impfstoffe aus transgenen Tabakpflanzen
Ein wichtiger Zweig der Gentechnologie ist die Entwicklung
pharmazeutischer Produkte, hauptsächlich von Impfstoffen
aus transgenen Tabakpflanzen, denn Tabak ist genetisch leicht
zu verändern und die Wartezeit bis Ergebnisse zu beobachten
sind ist relativ kurz, nachteilig ist allerdings dass Tabak nicht
zum Verzehr geeignet ist.
Die transferierten Stoffe werden dann aus der Pflanze extrahiert
und auf ihre immunologische Wirkung überprüft. Das
extrahieren der gewünschten oder erhofften Wirkstoffe geschieht
in einer Art Mixer in dem die Blätter zerkleinert werden.
"Aus dem so gewonnenen Saft isolieren wir die gewünschten
Proteine beispielsweise, indem die Moleküle in Chromatographiesäulen
voneinander getrennt werden." Quelle: Fraunhofer-Magazin
2.2001
beschreibt der Biologe Dr. Stefan Schillberg vom Fraunhofer-Institut
für Umweltchemie und Ökotoxikologie IUCT, Abteilung
Molekulare Biotechnologie das Verfahren.
Die gentechnische Produktionsweise hat den großen Vorteil,
dass nicht mit infektiösen Krankheitserregern, sondern mit
den nicht infektiösen Teilen der Erbsubstanz gearbeitet
werden kann.
"Die Pflanzen erzeugen keine bakteriellen Giftstoffe,
Viruspartikel oder Krankheitserreger wie etwa BSE, die den Menschen
gefährden können.", führt Dr. Stefan
Schillberg an.
Die angeführten Beispiele sollen die Möglichkeiten
der Gentechnik, die vermutlich unerschöpflich sind, aufzeigen.
Hepatitis B ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten;
weltweit haben nach WHO-Angaben ca. zwei Milliarden Menschen
eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) durchgemacht.
Pro Jahr wird mit bis zu einer Million Todesfälle durch
HBV-bedingte Leberzirrhose und Leberzellkarzinom gerechnet
"Die Forschung und Entwicklung eines Impfstoffs in
transgenen Pflanzen ist mit dem Hepatitis B Virus am weitesten
fortgeschritten. Der Impfstoff ist ein Untereinheits-Impfstoff,
der bestimmte Oberflächenantigene -sog. Histokompatibilitätsantigene
(HBsAg) - enthält (Pschyrembel, 1990). Erste Ansätze
für dessen Herstellung in gentechnisch veränderten
Pflanzen wurden bereits Anfang der 90er Jahre verfolgt. Mason
& Arntzen (1995) konnten in transgenen Tabak den Impfstoff
mit einem Anteil von ca. 0,01% der gesamten löslichen Proteine
herstellen." Quelle: http://www.oeko.de/bereiche/gentech/newslet/newsspe3.html#31
Als Überträger (Vektor) des Gens fungierte wieder
das Bodenbakterium Agrobacterium.
Durchfallerkrankungen sind schon in ihrer einfacheren Art
(etwa bei einem sogenannten verdorbenen Magen) extrem lästig
und auch gefährlich. Besonders Kinder in den ärmeren
Ländern leiden immer wieder unter dieser Krankheit die vielfach
durch verunreinigtes Wasser hervorgerufen wird und zu einem lebensbedrohenden
Zustand führen kann.
Aus transgenem Tabak wurde ein Antigen, das Enterotoxin Subunit
B (LT-B), das dem CTB
(Cholera Toxin Subunit B) sehr ähnlich ist produziert dass
die gefürchteten Escherichia coli Bakterien (ETEC) die für
Durchfallerkrankungen bei Kleinkindern in Entwicklungsländern
verantwortlich sind bekämpfen soll. ETEC ist neben anderen
bakteriellen und viralen Erregern auch eine Ursache für
den sogenannten Reise-Durchfall der durch infiziertes Trinkwasser
oder Lebensmittel herbeigeführt werden kann. Das Immunität
verleihende Antigen wurde nicht nur in transgenem Tabak sondern
auch in Kartoffeln hergestellt, allerdings nur in sehr geringen
Mengen. Eine orale Immunisierung von Mäusen mit rekombinanten
LT-B hat eine zu mikrobiell erzeugtem LT-B vergleichbare Immunantwort
hervorgerufen
"Karies-Bekämpfung: Das Oberflächenprotein
von Streptococcus mutans, dem Hauptverursacher von Karies, wurde
in Tabak produziert, allerdings konnte nur eine Konzentration
von 0,02% des gesamten Blatt-Proteins erreicht werden (Mason
& Arntzen, 1995). Eine passive Immunisierung durch sog. monoclonale
Antikörper, die in transgenem Tabak produziert wurden, hat
bei Testpersonen eine Wiederbesiedelung der Mundhöhle mit
Streptococcus mutans für mindestens 4 Monate verhindert."
Quelle: Gentechnische Nachrichten Spezial 3
Eine sehr gefährliche und unter Umständen zum Tode
führende Infektionskrankheit ist die Tollwut. Sie wird durch
den Biß oder Schleimhautkontakt eines erkrankten Tieres
auf den Menschen übertragen und ist, wenn kein Gegenmittel
geimpft wird, tödlich. Nach Schätzungen des WHO werden
jährlich ca. 60.000 tödlich verlaufende Erkrankungen
der Menschen registriert.
Eine ursächliche Behandlung der Tollwut ist nicht möglich.
Aufgrund der meist langen Inkubationszeit (drei Wochen bis zu
einem Jahr) ist jedoch eine sofortige aktive Immunisierung mit
fünf aufeinander folgenden Impfungen in der Regel erfolgreich;
gleichzeitig wird meist mit der ersten Impfung eine passive Immunisierung
mit Tollwutimmunserum vorgenommen. Die Tollwut-Antikörper
wurden bisher aus erkrankten Menschen oder Pferden isoliert.
Es ist einer Gruppe von Wissenschaftlern der Thomas-Jefferson-Universität
in Philadelphia/USA gelungen aus transgenen Tabak Antikörper
gegen die Tollwut zu erzeugen. Im Tierversuch erwies sich der
pflanzliche Antikörper als genauso wirksam wie der nach
traditioneller Methode gewonnene.
Antikörper konnten, um dies noch anzuführen, auch aus
der Tomate (ebenfalls ein Nachtschattengewächs) gewonnen
werden.
Das Norwalk Virus aus der Familie der Caliciviridea ist Hauptverursacher
viraler Durchfallerkrankungen, es wird angenommen dass 30% aller
Kinder und 50% der Erwachsenen die an einem nichtbakteriellen
Durchfall erkrankt sind von diesen Viren infiziert wurden. Die
Krankheitserreger werden über den Stuhl ausgeschieden und
dann auf fäkal-oralem Wege oder durch kontaminiertes Trinkwasser
oder Lebensmittel übertragen. Den Namen erhielt diese Krankheit
nach der Ortschaft Norwalk/ Ohio/USA, dort kam es in den 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts zu einem Ausbruch von damals
unerklärlichen Durchfallerkrankungen.
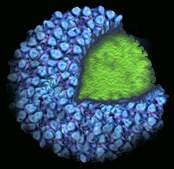
Bild 6: Norwalk Virus
Versuche bei denen Mäuse mit einer Sonde Hüllproteine
aus transgenem Tabak verabreicht wurden zeigten Virus spezifische
Immunreaktionen.
Die Entwicklung von Impfstoffen in transgenen Pflanzen steht
erst an einem Anfang, viele der Medikamente befinden sich noch
in einer experimentellen Erprobungsphase in den Labors der Gentechniker.
Bis diese Ergebnisse und Erkenntnisse in der Human und Veterinärmedizin
angewendet werden können wird es noch ein langer Weg werden,
aber ein Anfang wurde gemacht.
Beispiele für die Herstellung von Arzneimitteln in
Pflanzen
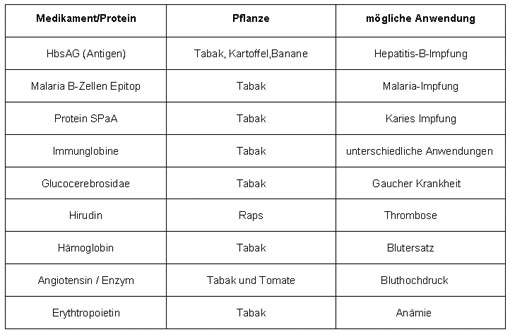
Quelle der Tabelle: http://www.monsanto.de/Service/broschueren/KompFinalBand2_5Aufl062003.pdf
Weitere gentechnische Experimente mit Tabak
Wir wollen nun unsere Aufmerksamkeit auf einige Experimente
und Forschungsergebnisse mit der Tabakpflanze richten.

Bild 7: Photinus pyralis
1986 gelang es einigen amerikanischen Wissenschaftlern das
Luciferase-Gen aus nordamerikanischen Leuchtkäfern (Photinus
pyralis) auf Tabakpflanzen zu übertragen. Dies geschah mit
dem uns nun schon bekannten Agrobacterium Plasmid als Überbringer
und einem Cauliflower-Mosaikvirus-Promotor (Anmerkung 6). In
das Nährmedium wurde Luciferin gegeben und es trat eine
kräftige Lumineszenz auf. Solch ein Experiment mag auf den
ersten Blick als Spielerei angesehen werden, ist jedoch von Wichtigkeit
um bestimmte Marker-Gene zu erschaffen. Marker-Gene dienen dazu,
der Name deutet es an, transferierte Gene in einer Wirtspflanze
sichtbar zu machen.
Auch in der Medizin könnten solche fluoriszierenden Gene
eingesetzt werden: Wissenschaftler vom University College in
London konnten in Krebszellen durch Luciferin Biolumineszenz
auslösen und die Zellen auf diese Weise abtöten.
"Die Wissenschaftler brachten nun Krebszellen dazu,
das Enzym Luciferase zu produzieren. Fügten sie dann den
Zellen von außen Luciferin zu, leuchteten die Zelle. Wenn
die Zellen zusätzlich noch bestimmte Substanzen enthielten,
die durch Licht aktiviert werden und in der Folge die Zelle abtöten,
führte diese Behandlung zum Zelltod."
Quelle: http://www.wissenschaft.de/wissen/news/drucken/209599
 |
 |
|
Bild 8: bioluminiszenz Tabak |
Bild 9: bioluminiszenz bei Meerestier |
Vielleicht führen weitere Forschungen in dieser Richtung
eines Tages auch zu Erfolgen für die Human-Medizin.
Der Spinnenfaden (Spinnenseide) ist eine sehr reißfeste
und extrem dehnbare Faser die sich aus verschiedenen Proteinen
zusammensetzt. Wissenschaftlern um Udo Conrad vom Institut für
Pflanzengenetik in Gatersleben gelang es diese Faser durch Genübertragungen
im Tabak (und in der Kartoffel) zu erzeugen, sie verwendeten
dafür ein Gen der amerikanischen Goldseidenspinne auch Goldnetzspinne
(Nephila clavipes) genannt.
Die neugewonnenen Fasern wiesen eine bis zu 90% Ähnlichkeit
mit natürlichen Spinnenfäden aus. Die aus transgenen
Tabak gewonnen Fäden zeichnen sich durch eine sehr hohe
Reißfestigkeit aus die sonst in industriell hergestellten
Fasern nur von Kevlar erreicht wird, außerdem besaßen
sie eine hohe Elastizität und waren extrem Hitzebeständig.
In Zusammenarbeit mit dem Thüringischen Institut für
Textil- und Kunststoffforschung in Rudolstadt gab es bereits
erste Webversuche für die transgenen Faser, sie verliefen
jedoch nicht befriedigend.
"Spinneneiweiß verursacht bei Menschen keine
allergischen Reaktionen, deshalb ist es hervorragend für
Anwendungen in Medizin und Forschung geeignet." Das wussten
schon die alten Römer, die Wunden mit Spinnennetzen bedeckten.
Auch weniger friedlichen Zwecken dürfte der Stoff dienen:
Das kanadische Militär fördert die Forschung nicht
zuletzt deshalb, weil es an Fallschirmen und schusssicheren Westen
aus den starken Fasern interessiert ist. Und schließlich
gibt es kein besseres Material für Kletterseile. Im Falle
eines Falles gibt der Spinnenfaden zuerst nach und bremst den
unglücklichen Gipfelstürmer dann sanft, aber sicher."
Quelle: Stuttgarter Zeitung 15.6.2001
Die Chloroplasten gehören zu den Plastiden und sind Zellbestandteile
die einen eigenen Satz von Genen besitzen. Chloroplasten sind
für die Photosynthese der Pflanze verantwortlich. Die Photosynthese
ist für das Leben von größter Bedeutung, sie
ist der wichtigste Prozess in der Nahrungskette der Lebewesen
denn durch sie wird Lichtenergie zur Bildung von Kohlenhydraten
aus Wasser und Kohlendioxid umgewandelt.
Wissenschaftlern der Australian National University in Canberra
ist es erstmals gelungen die Photosynthese in den Chloroplasten
von Tabakpflanzen gentechnisch zu verändern.
Die Wissenschaftler Spencer Whitney und T. John Andrews tauschten
das Tabakeigene Gen für das so genannte RuBisCO-Enzym gegen
das aus der Rotalge Rhodospirillum rubrum aus. RuBisCO ist das
wichtigste Enzym bei der Aufnahme des Kohlenstoffs aus der Luft
durch die Pflanzen. Die Wissenschaftler erhoffen sich, mit vergleichbaren
Eingriffen die an anderen Nutzpflanzen vorgenommen werden die
Effizienz der Photosynthese wesentlich zu erhöhen. Das bedeutet:
Die verwertbaren Teile (Wurzel, Blätter oder Früchte)
der behandelten Pflanze sollen durch diese Genmanipulation größer
und wohlschmeckender werden. Gleiches ist Gentechnikern in den
Universitäten Freiburg und Münster gelungen, allerdings
nahmen sie dazu keinen Tabak sondern Tomaten. Diese Früchte
werden als reizvolleres Forschungsobjekt als die Tabakpflanzen
angesehen, da diese sehr viele Stoffe produziert die ungesund
oder toxisch (Nikotin) sind.
Gentechnische Eingriffe in die Chloroplasten sind deshalb von
besonderer Bedeutung und Wichtigkeit weil die erzeugten Gene
nicht auf andere Pflanzen übertragen werden.
Zu den ältesten Hormonen das alle Lebewesen schon von
Beginn der Zeit in sich tragen, gehört das Wachstumshormon
Somatotropin, abgekürzt STH (es wird auch gern der Begriff
(human Growth Hormone, hGH) verwendet), das den Einbau von Aminosäuren
und Eiweiß in die Zelle fördert und somit alle jene
Prozesse steuert die zum Aufbau von Organen verwendet werden.
Fehlt das Hormon in der Kindheit so ist Zwergenwuchs die daraus
resultierende Folge, ein zuviel verursacht Gigantismus bzw. Akromegalie.
Bei Erwachsenen war der Stellenwert des Hormons lange Zeit unklar.
Inzwischen ist bekannt dass mangelndes Wachstumshormon die Eiweißsynthese
drosselt: Die Folgen davon sind gravierend: Muskel- wird in Fettgewebe
umgewandelt.
Das Wachstumshormon wird in der Hirnanhangsdrüse gebildet
und ist eines von fünf Hormongruppen, die im Hypophyse-Vorderteil
hergestellt werden. Vor der gentechnischen Herstellungsmöglichkeit
musste dieses Medikament aus den Hirnanhangsdrüsen Verstorbener
isoliert werden. Amerikanischen Wissenschaftlern des Gentechnik
Konzerns Monsanto in St. Louis gelang nun ein großer und
entscheidender Durchbruch: Es gelang ihnen die Gene des Hormons
in die DNA der Chloroplasten von Tabakpflanzen einzubauen. Sie
produzieren nun das für die Behandlung kranker Kinder so
wichtige Hormon. Allerdings findet das hGH auch bei Sportlern
als Doping-Mittel eifrige Verwendung. Die Fälle bei denen
Sportler mit diesem Hormon im Handgepäck erwischt wurden
sind zahlreich gehören aber nicht in den Rahmen dieses Artikels.
Aluminium (Zeichen Al) ist das dritthäufigste Element
und häufigste Metall in der Erdkruste, in der es in Form
von Oxiden und Aluminiumsilicaten vorliegt. Aluminium gilt als
Spurenelement im Stoffwechsel der Pflanzen. Es ist für Farne
und Schachtelhalme lebensnotwendig, besonders hoch ist der Gehalt
von Aluminium im Teestrauch (Teestrauchgewächse): er erreicht
dort bis zu 5000 mg/kg Trockengewicht, während er bei anderen
Höheren Pflanzen ca. 200 mg beträgt. Aluminium ist
Bestandteil des Bodens (Bodenentwicklung) und wirkt dort unter
gewissen Umständen und Bedingungen bei zu hoher Konzentration
als Wurzelgift, als Folge kann es zu erheblichen Störungen
des Wachstums kommen.
Einige Pflanzen besitzen die Fähigkeit sich gegen ein zuviel
an Al bei der Nährstoffaufnahme zu wehren. Sie setzen über
ihre Wurzeln Aluminium ausfällendes Citrat (Zitronensäure)
oder Malat (Apfelsäure) aus.
"Das für die Bildung von Citrat verantwortliche
Enzym Citratsynthase wurde aus Bakterien in die Modellpflanze
Tabak übertragen. Bei den transgenen Tabakpflanzen konnte
nicht nur eine erhöhte Citratkonzentration im Cytoplasma,
sondern auch eine vermehrte Abgabe von Citrat in den Wurzelraum
nachgewiesen werden. In Kultivierungsversuchen bei unterschiedlichen
Aluminiumkonzentrationen zeigte transgener Tabak stets ein besseres
Wurzelwachstum als unbehandelte Kontrollpflanzen. Unklar ist
bisher, ob sich diese Ergebnisse auch im Freiland wiederholen
lassen und ob die Mehrproduktion von Citrat nicht auf Kosten
anderer Stoffwechselwege geschieht. Fraglich ist auch, ob sich
so die Erträge auf sauren Böden steigern lassen, da
noch zahlreiche andere Umwelt- und Bodenfaktoren die Erntemenge
beeinflussen. "
Quelle: http://www.wissenschaft-online.de/artikel/574856
Zu guter Letzt wollen wir noch einen Blick auf Nelken der
niederländischen Firma Florigene Europe werfen. Um ihre
Haltbarkeit zu erhöhen wurden Nelken gentechnisch behandelt,
sie erhielten unter anderem ein Herbizidresistenz-Gen aus Tabak.
Die damalige? nordrhein-westfälische Umweltministerin Bärbel
Höhn warnte davor dass:
"...die Herbizidresistenz sich über den Pollen
unter Umständen auf die einheimischen Nelkenarten übertragen
könnte. Außerdem seien die länger blühenden
Nelken nicht gerade arbeitsmarktfreundlich. "Da bin ich
gespannt, wo die von den Befürwortern der Gentechnik versprochenen
zusätzlichen Arbeitsplätze entstehen werden. Und angesichts
der Ankündigung, daß die Gentechnik die Lebensqualität
der Menschelt verbessern soll, sind die Nelken schon ein erstaunlicher
Beitrag.", so die grüne Ministerin.
Quelle: http://www.gen-ethisches- netzwerk.de/gid/TEXTE/ARCHIV/PRESSEDIENST_GID132/NOTIZEN132.HTML
Hier wäre eine gute Gelegenheit um über die Risiken
der Gentechnik nachzudenken. Dies würde aber den Rahmen
dieses Artikels überschreiten, wir würden uns zu weit
vom Thema entfernen. Der interessierte Leser wird aber mit Sicherheit
zu diesem Thema in den Medien oder im Internet fündig.
Freisetzungen
werden die landwirtschaftlichen Flächen genannt, auf
denen mit behördlicher Genehmigung genveränderte Pflanzen
innerhalb der EG angebaut werden dürfen. Mit Anbauversuchen
unter sehr streng kontrollierten Bedingungen wird dabei überprüft
ob gentechnisch veränderte Pflanzen für die Praxis
tauglich sind. Freilandversuche sind sehr umstritten weil die
Risiken die dabei entstehen können noch nicht in ausreichenden
Maße erforscht sind.
In der Bundesrepublik gilt das Gentechnikgesetz (GenTG) dass
die EU Richtlinien ( am 17. Oktober 2002 trat die neue EU-Freisetzungsrichtlinie
2001/18/EG in Kraft)in nationales Recht umsetzt.
In Deutschland entscheidet das Robert-Koch-Institut über
das Freisetzen und Inverkehrbringen von GVO's. Die Genehmigung
für das Inverkehrbringen nach der Freisetzungsrichtlinie
90/220/EWG und seinen Folgebestimmungen erfolgt durch die EU-Kommission.
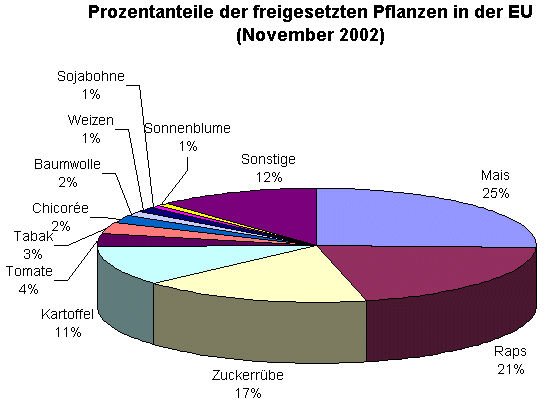 Bild 10
Bild 10
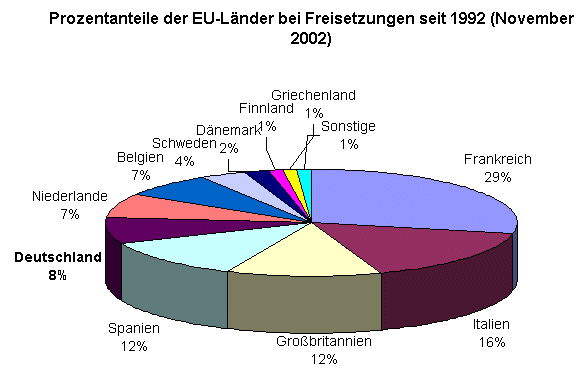 Bild 11
Bild 11
Unsere Nutzpflanzen besitzen ein enormes Potenzial zur Gewinnung
von Impfstoffen, therapeutisch wertvoller Eiweiße und Medikamenten,
es muss nur sinn-und verantwortungsvoll genützt werden.
Für die Herstellung dieser wichtigen Proteine, für
die Freisetzungen transgener Pflanzen in landwirtschaftlich genützten
Flächen aber auch für die Pflanzenzucht in den Labors
der Genetiker hat sich im Laufe der Jahre ein neues Wort etabliert:
Gen-Farming, auch Molecular Farming genannt.
Anträge zur Freisetzung von GVO: Kulturpflanzen
und Mikroorganismen in den EU-Ländern

Stand: April 2003, Quelle: http://www.bba.de/gentech/tab1.htm
Und damit sind wir nun am Ende dieses Artikel angekommen.
Ich danke dem Leser für seine Geduld.
Quellennachweis Bilder:
Bild 1 Internet
Bild 2 http://uni-schule.san-ev.de/space/AG_Bickel/se2/botanik2/transgen.htm
Bild 3 http://www.science-live.de/themen/landwirt.htm
Bild 4 Kermesbeere: http://www.botanikus.de/Gift/kermes.html
Bild 5 Internet
Bild 6 Norwalk Virus: http://www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/norwalkvirus.html
Bild 7 Internet
Bild 8 http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-11.htm
Bild 9 http://www.uni-jena.de/chemie/institute/ oc/weiss/lumineszenz.htm
Bild 10 und Bild 11 http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten/bsg/bsg14.htm
Quellen:
Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Bakterien - Gentechnik
Quelle: http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/d34/34.htm
Gentechnik Nachrichten 35
http://www.biogene.org/pdf/35%20August%20bis%20September%2002-d.pdf.
Gentechnologie II
http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-11.htm
Umweltbundesamt
http://www.umweltbundesamt.de/index.htm
Gentechnik und Pflanzenzüchtung
http://www.plantbreeding.uni-kiel.de/projekte/gentechnik_und_pflanzenzuechtung.htm
Transgen
http://www.transgen.de/
Gentechnik
http://www.zum.de/Gentechnik/Anwendungen.html
Effekte transgener insektenresistenter Bt-Kulturpflanzen
http://www.biogene.org/e/themen/biotech/wwf.htm
Gentechnik Nachrichten 26
http://www.oeko.de/bereiche/gentech/newslet/documents/26sept01-d.pdf.
Gentechnisch veränderte Pflanzen
http://www.gsf.de/IU/index.html
Der Weinbau in Mitteleuropa
http://www.uni-hohenheim.de/lehre370/weinbau/biologie/vitaceae.htm
Freisetzung transgener Pflanzen
http://www.gruene-biotechnologie.de/downloads/freisetzung.pdf.
Gentechnik und Lebensmittel
http://www.bfa-ernaehrung.de/Bfe-Deutsch/Information/e-docs/janyberi.htm
Glufosinat
http://www.bayercropscience.de/imperia/md/content/gruene_gentechnik/info_shop/broschueren_pdf/1.pdf
Grüne Gentechnologie
http://www.monsanto.de/biotechnologie/gen_lebensm/daten/kapitel_1/1_05_2/set_1_05_2.htm
Rekombinante Bacillus thuringiensis Toxin Pflanzen in Land-
und Forstwirtschaft
http://ifff.boku.ac.at/Endber1.htm
Fragen der Herbizidresistenz bei genetisch veränderten
Pflanzen
http://www.gentechnik.gv.at/gentechnik/B1_orientierung/gen_10021.html
Statistik Bundesamt
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten/bsg/bsg14.htm
Liste gentechnisch veränderter Lebensmittel,
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/wwwalt/themen/food/lmliste.html
Gentechnik Nachrichten Spezial 3
http://www.oeko.de/bereiche/gentech/newslet/newsspe3.html#31
Luciverin
Quelle: http://home.arcor.de/ralf.sitter/kyb/bionik/lucifer.htm
Bild Leuchtkäfer
http://www.enature.com/fieldguide/showSpeciesGS.asp?searchText=Pyralis+Firefly&curPageNum=1&recnum=IS0025
Glühwürmchen-Prinzip bringt Krebszellen den Tod
Quelle: http://www.wissenschaft.de/wissen/news/drucken/209599
Spinnenseide
http://www.wissenschaft.de/wissen/news/155394
Genomxpress (Science Digest)
http://www.dhgp.de/media/xpress/genomxpress02_01/sciencedigest.html
Stuttgarter Zeitung vom 15.6.2001
Pflanzen und Gentechnik: Transgene Pflanzen, transgenes Essen
Quelle: http://www.biologie.uni-ulm.de/bio2/knoop/plantgene/plantgen.html
Antikörper aus Tabak gegen Tollwut
http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/nano/sp/40003/
Gen-ethischer Informationsdienst (GID) 151
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/TEXTE/ARCHIV/PRESSEDIENST_GID151/LANDWIRTSCHAFT151.HTML
Aluminium
http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/bio/2560
Norwalk-Virus
http://www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/norwalkvirus.html
Wachstumshormon
http://www.drhuber.at/wachstumshormon.htm
http://www.dopingnews.de/Wachstumshormon.html
Roche Lexikon Somatotropin
http://www.gesundheit.de/roche/ro35000/r36068.html
Aluminium
http://www.wissenschaft-online.de/artikel/574856
Anmerkungen:
Anmerkung 1
Ribonucleinsäure,
(Abkürzung RNS, englisch RNA), Polynucleotid (Nucleinsäuren),
dessen Monomereinheiten aus einer Pentose (Ribose), einer Purin-
(Adenin, Guanin) oder Pyrimidinbase (Cytosin, Uracil) und einem
Phosphorsäurerest im Verhältnis 1ÿ:ÿ1ÿ:ÿ1
bestehen, wobei durch alternierende Verknüpfung von Phosphorsäurerest
und Ribose eine unverzweigte Kette entsteht. Die Transfer-RNA
(tRNA) fungiert als Aminosäureüberträger bei der
Proteinbiosynthese, die Boten- oder Messenger-RNA (mRNA) als
Informationsüberträger bei der Proteinbiosynthese,
die ribosomale RNA (rRNA) ist Bestandteil von Ribosomen. Bei
RNA-Viren ist eine virale RNA anstelle der DNA Träger der
genetischen Information.
© 2002 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus
AG
Anmerkung 2
Pflanzensauger
(Gleichflügler, Homopteren, Homoptera), weltweit verbreitete
Ordnung wanzenartiger Landinsekten. Pflanzensauger besitzen einen
Saugrüssel zum Einsaugen von Säften aus pflanzlichem
Gewebe; die vier weichhäutigen Flügel sind soweit vorhanden
gleichartig häutig ausgebildet (anders als bei den Wanzen);
unvollkommene Verwandlung. Viele Arten schädigen Kulturpflanzen.
Man unterscheidet Pflanzenläuse und Zikaden.
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG
Gleichflügler
(Pflanzensauger, Homoptera), weltweit verbreitete Ordnung pflanzensaugender
Landinsekten mit etwa 30000 Arten. Man unterscheidet die Unterordnungen
Blattläuse, Blattflöhe, Schildläuse, Zikaden,
Mottenschildläuse.
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG
Anmerkung 3
Was sind Lektine?
Lektine sind Proteine (Eiweißstoffe) oder Glycoproteine
(Eiweißstoffe mit zusätzlich gebundenen Zuckerresten),
meist pflanzlichen Ursprungs, die spezifisch an Zuckerreste von
Zellwänden oder Zellmembranen gebunden werden.
Diese Reaktion verändert die Physiologie der Zellmembran
und wirkt sich damit auf verschiedenste Stoffwechselvorgänge
aus: Bestimmte Pflanzenlektine beeinflussen z.B. die Zellteilung
oder das Immunsystem, andere führen zur Agglutination von
Zellen, z.B. von Erythrocyten. Daher rührt auch ihre alte
Bezeichnung (Phyto)-Hämagglutinine.
Vorkommen in der Nahrung
Lektine sind vor allem in Pflanzen weit verbreitet, insbesondere
in den Samen; manche von ihnen sind ziemlich giftig, andere dagegen
unschädlich. Zu den bekanntesten Lektinen gehören die
aus Hülsenfrüchten (z.B. das Phasein aus Bohnen). Sie
sind für Mensch und Tier toxisch und werden durch Kochen
zerstört. Es gibt auch andere, nicht toxische Lektine, die
resistenter gegenüber Hitze sind. Da auch viele pflanzliche
Produkte roh verzehrt werden, ist der Verdauungstrakt von Mensch
und Tier diesen Substanzen regelmäßig ausgesetzt.
Das am besten untersuchte pflanzliche Lektin ist Concavalin A
(Con A) aus den Samen der Jackbohne Canavalia ensiformis, wo
es in großer Menge vorkommt. Es gehört ebenso wie
das Weizenkeimlektin zu den wenigen Lektinen, die keinen gebundenen
Zucker enthalten. Auch Kartoffeln enthalten Lektine. Diese haben
besonders viele gebundene Zuckerreste.
Biologische Wirkung
Während die Wirkung von Lektinen auf tierische Zellen intensiv
erforscht wird, ist über ihre biologische Rolle in der Pflanze
wenig bekannt. Im Gegensatz zu den Proteinen der Nahrung überleben
viele Lektine die Passage durch den Verdauungstrakt in intakter
Form. Lektine binden sich an die Wand des Dünndarms und
besetzen so die Plätze, die andernfalls von Bakterien eingenommen
würden. Sie scheinen damit die Anheftung schädlicher
Bakterien an die Darmschleimhaut blockieren zu können.
Pflanzenlektine können für verschiedene Tiere unterschiedlich
schädlich sein. Da manche Lektine für bestimmte Insekten
toxisch sind, werden sie als natürliche Insektizide bzw.
Pestizide gesehen, welche die Pflanze vor dem Schädlingsbefall
schützen.
Die gentechnische Forschung in diesem Bereich konzentriert sich
darauf, solche Lektingene (z.B. das Gen von Galanthus nivalis
Agglutinin, GNA, aus Schneeglöckchen) in Pflanzen zu übertragen,
um sie vor solchen Schädlingen zu schützen.
Anmerkung 4
Polyphenole
sind sekundäre Pflanzenstoffe, die in verschiedene einzelne
Stoffklassen unterteilt werden. Den Polyphenolen ist gemeinsam,
dass sie meistens aus ringförmigen Molekülen bestehen,
die in der Lage sind Elektronen leicht aufzunehmen. Zu den Polyphenolen
gehören zum Beispiel die im Grünen Tee, die in den
verschiedene Teilen der Weinrebe (Blätter, Beerenhaut) oder
in Olivenblättern enthalten wirksamen Substanzen, die sogenannten
Flavonoide. Auch die zahlreichen roten bis blauen Pflanzenfarbstoffe
in Früchten und Blüten, die Anthocyane, gehören
zu den Polyphenolen. Besonders wirkungsvolle natürliche
Schutzsubstanzen sind die Proanthocyanidine (OPC).
Quelle: http://www.atlantis-pharm.com/polyphenole.htm
Anmerkung 5
Samen der herbizidresistenten Tabaksorte ITB 1000 OX"
1) Registernummer: 0001
2) Genehmigungszeitpunkt des Inverkehrbringens: 8.6.1994
3) Bezeichnung des Erzeugnisses und der darin enthaltenen GVO:
Samen der herbizidresistenten Tabaksorte ITB 1000 OX (C/F/93-08-02);
sterile männliche Hybride, die gegenüber dem Herbizid
Bromoxynil resistent sind und das Nitrilasegen aus Klebsiella
ozaenae, den Promotor RuBis-COSSU aus Helianthus annuus und den
Nopalinsynthasegenterminator von Agrobacterium tumefaciens pTiA6
enthalten.
4) Namen und Anschrift des Herstellers des Erzeugnisses oder
des Importeurs, sofern das Erzeugnis aus einem Staat eingeführt
wird, der nicht Mitglied des EWR ist:
Société Nationale d' Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes (Seita),
Domaine de la Tour, F-24100 Bergerac
5) Angaben über die durch die gentechnische Veränderung
erwirkten besonderen Eigenschaften des Erzeugnisses:
Toleranz gegen Herbizide mit dem Wirkstoff Bromoxynil
6) Genaue Einsatzbedingungen, gegebenenfalls einschließlich
der Umweltgegebenheiten oder des geographischen Bereichs der
EWR-Staaten, für den sich das Erzeugnis eignet:
Tabakwaren; keine Einschränkungen, ausgenommen jene, die
sich aus den landwirtschaftlichen Bedingungen dieser Züchtung
ableiten.
7) Angaben über die im Falle einer unbeabsichtigten Verbreitung
oder eines Mißbrauchs zu ergreifenden Maßnahmen:
Maßnahmen wie bei konventionellem Tabak
8) Spezifische Anleitungen oder Empfehlungen betreffend Lagerung
und Handhabung:
Keine Einschränkung für Gebrauch noch Handhabung, spezielle
Kennzeichnung ist für die Saatgutsäcke vorgesehen.
Quelle: http://www.gentechnik.gv.at/gentechnik/gesetz/Gentechnikregister.html
Anmerkung 6
Promotor
... ist die Bezeichnung für den DNA-Bereich eines Gens,
der den Startpunkt für das Umschreiben des Gens in der RNA
markiert. Das ist der erste Schritt der Proteinsynthese (Transkription).
Zudem regulieren Promotoren die Effizienz der Transkription und
damit die Menge des gebildeten Eiweißes. Um ihre Funktion
zu erfüllen, treten Promotoren mit Proteinen in Wechselwirkung.
Der Komplex aus Promotor-DNA und Proteinen vermittelt wiederum
die Bindung verschiedener RNA-Polymerasen, welche Ribonukleinsäure
synthetisieren. Die Aktivität des Promotors kann ferngesteuert
werden: durch enhancer-Sequenzen auf der Erbsubstanz. Diese Verstärker-Abschnitte
auf der DNA liegen oft mehrere tausend Basenpaare vom Promotor
entfernt. (nsi)
Quelle: http://www.aerztezeitung.de/docs/2000/10/27/193a1203.asp
|