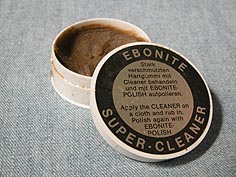Es genügt allerdings nicht, einen verwurstelten Pfeifenreiniger
durch den Rauchkanal zu ziehen und die Pfeife dann bis zum nächsten
Gebrauch wegzulegen. Wenn man aber die wichtigsten Arbeiten regelmäßig
ausführt, ist die Sache in ein paar Minuten erledigt und man wird
mit sauberen, gut zu rauchenden und schön anzusehenden Pfeifen
belohnt.
Die verschiedenen Reiniger
Was würde uns die beste Pfeife, der edelste Tabak nützen,
wenn wir nicht an jedem Kiosk unsere Pfeifenreiniger bekämen.
Ohne sie würden unsere Pfeifen schnell zu stinkenden und
sotternden Jauchetöpfen mutieren. Für die gründliche
Reinigung bietet die Industrie sogar verschiedene Ausführungen
an, die ich hier kurz vorstellen möchte. |
| |
|
 |
Da wäre zuerst der einfache, ziemlich
dünne Baumwollreiniger. Er stellt die Ursprungsform aller
Reiniger dar und ist in allen erdenklichen Farben auf dem Markt.
Seine hohe Saugkraft prädisteniert ihn zum Beispiel für
die Aufnahme des Kondensats im Mundstück.Für alle Reinigertypen
gilt, das sie manchmal Flusen verlieren, die den Rauchkanal verstopfen
können. Ich ziehe sie deshalb vor Gebrauch ein paar mal zwischen
Zeigefinger und Daumen durch. |
 |
Der Allroundreiniger ist der konische mit eingewobenen
Kunstoffborsten. Sein Draht ist stärker als der des eingangs
genannten und durch die Bürsten löst er auch festsitzenden
Schmutz. In manchen Läden findet man einen Reiniger mit noch
härteren Bürsten. Dieser ist dann für die Härtefälle
gedacht bei denen der Rauchkanal wegen ausgebliebener Reinigung
bereits mit Rückständen langsam zuwächst. Aber so
weit lassen wir es ja gar nicht erst kommen. |
| |
Grundreinigung
Das Wichtigste gleich am Anfang: eine großzügig ausgebreitete
Zeitung auf dem Arbeitstisch bietet sich für alle unten aufgeführten
Arbeiten an und hilft Ärger zu vermeiden. |
| |
|
 |
Nachdem die Pfeife ausgekühlt ist (ca.
20 – 30 Minuten nach dem Rauchen) wird das Mundstück
durch Rechtsdrehung und gleichzeitigem Ziehen vom Holm getrennt.
Mit einem in der Mitte geknickten Reiniger wird nun der Rauchkanal
des Kopfes ordentlich gesäubert. Dieser Vorgang wird mit
frischen Reinigern so lange wiederholt, bis der Reiniger sauber
bleibt. |
 |
Der Rauchkanal des Mundstücks dürfte
nach dem Einsatz von einem oder zwei Reinigern gesäubert sein.
Bei Filterpfeifen kommt jetzt noch ein Papiertuch zum Einsatz. Zu
einem Pfropf gedreht eignet es sich hervorragend zur Reinigung der
Filterbohrung und des Mundstückszapfens. Hierbei ist es wichtig,
den Pfropfen nicht zu dick zu wickeln, damit man bis in die letzten
Ecken kommt und den Zapfen nicht durch zu viel Druck sprengt. Die
Pfeife wird nun wieder mit einer Rechtsdrehung zusammengesetzt und
darf sich mindestens einen Tag ausruhen. |
| |
Intensivreinigung
Je nach Art des verwendeten Tabaks (Feuchtigkeit, Saucierung, Abbrandverhalten)
wird es von Zeit zu Zeit nötig, die Grundreinigung durch die
Zuhilfenahme von alkoholischen Zusätzen zu intensivieren. |
| |
|
 |
Auf dem Markt gibt es spezielle Pfeifenreinigungsflüssigkeiten
wie etwa Deniclean, Piter oder die kleinen Ampullen, die den rot-weißen
Blitzreinigern beiliegen. (Foto) Reiner Alkohol aus der Apotheke
oder Hochprozentiges wie Whisky, Rum oder Cognac funktionieren
auch tadellos. Ein in diese Flüssigkeit getauchter Reiniger
(bei Filterpfeifen auch der Papierpfropf) löst auch die letzten
Verschmutzungen und neutralisiert zusätzlich den Geruch der
Pfeife. Wichtig: nicht an die Außenseiten der Pfeife kommen
weil der Alkohol die Wachsschicht angreifen kann und ordentlich
mit trocknen Reinigern nachputzen. |
| |
Reduzieren der Kohleschicht
Nach einer gewissen Anzahl von Füllungen wird man feststellen,
dass die Schicht der Verbrennungsrückstände an den Wandungen
des Tabakraumes immer dicker wird. Hier sollte man frühzeitig
eingreifen und die Stärke auf ca. einen Millimeter reduzieren
um ein Zuwachsen zu vermeiden. Frühzeitig deshalb, weil beim
Reduzieren einer dicken Kohleschicht die Gefahr besteht, das sie
an manchen Stellen vollständig abplatzt, was bedeuten würde,
dass die Pfeife bis aufs Holz ausgeschabt werden müßte
um ein Durchbrennen zu vermeiden. Danach müßte sie vollständig
neu eingeraucht werden. |
| |
 |
Für das sogenannte „reamen“ des
Kopfes gibt es verschiedene Werkzeuge, die sogenannten Pfeifenschlüssel.
Von der einfachsten Ausführung (die auch nicht viel taugen)
bis zum „Senior-Reamer“ (Foto) gibt es einige dieser
unentbehrlichen Werkzeuge bei jedem Pfeifenhändler zu kaufen.
Ich möchte hier den Vorgang mit dem „Senior-Reamer“
beschreiben, weil ich ihn für praxistauglich halte und ihn
seit Jahren einsetze. |
 |
Die Weite der drei Schneidmesser lässt sich
mit einer Rändelschraube am oberen Ende an die entsprechende
Kopfgröße anpassen. Ich stelle den reamer so ein, das
er ca. einen Millimeter Spiel hat und fahre vorsichtig drehend damit
an der Innenwandung des Kopfes vorbei, wobei ich immer wieder prüfe,
wie stark die verbliebene Schicht noch ist und den Kohlestaub ausschütte.
Beim reamen ist rohe Gewalt absolut fehl am Platze. Nur durch vorsichtiges,
gewaltfreies Drehen lässt sich die Kohleschicht ohne Schaden
zu nehmen auf ein gesundes Maß reduzieren. Im Zweifelsfall
würde ich mir die Handhabung beim Kauf an einer mitgebrachten
Pfeife demonstrieren lassen. |
| |
|
Äußere Kosmetik
Nachdem die Innenreinigung abgeschlossen ist, widmen wir uns der
äußeren Erscheinung. Eine Pfeife soll schließlich
auch das Auge erfreuen. |
| |
|
 |
Beginnen wir mit einer recht hartnäckingen
Verunreinigung: die schwarzen Spuren des Feuerzeuges oder Streichholzes
am Kopfrand. Gerade bei breiten Wandungen ensteht nach wenigen Füllungen
eine erst braune und später zum Schwarz übergehende Schicht
durch das Anzünden. Es handelt sich hierbei nicht etwa um verkohltes
Holz, sondern eine im warmen Zustand klebrige, im kalten steinharten
Ablagerung. Wischt man während des Rauchens ab und zu mit einem
Tuch über den Rand, wird diese Verschmutzung gar nicht erst
entstehen, aber wer macht das schon. |
 |
Um der Sache zu Leibe zu rücken, nehme ich
ein Papiertuch oder einen Lappen und befeuchte ihn mit etwas Spucke.
Ja, Spucke. Das ist wirklich das beste Mittel um den schwarzen Belag
nachhaltig zu entfernen. Selbst Alkohol oder eine Maschinenpolitur
können da nicht mithalten. Durch die Feuchtigkeit ist der Kopfrand
nun etwas matt geworden, aber keine Angst, auch das bekommen wir
wieder hin. |
 |
Mit einem weichen Tuch wird Bruyere-Polish auf
dem gesamten Kopf aufgetragen und in das Holz einmassiert. Nach
ein paar Minuten wird mit einem zweiten Tuch nachpoliert und der
Kopf erstrahlt in neuem, seidenmatten Glanz. |
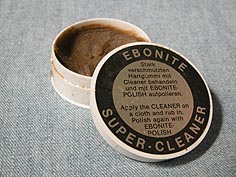 |
Ein trockenes Mikrofasertuch eignet sich hervorragend
um das Acryl-Mundstück wieder auf Hochglanz zu bringen. Die
Pfeife sieht wieder aus wie frisch aus dem Geschäft. Ist das
Mundstück allerdings aus Ebonit, kommt noch eine Ebonit-Politur
zum Einsatz. Auftragen, einziehen lassen, kräftig polieren
und auch dieses Problem gehört der Vergangenheit an. |
| |
|
Die Maschinenpolitur
Natürlich kann man mit einer maschinellen Politur noch bessere
und vor allem schnellere Ergebnisse erzielen. |
| |
|
 |
Wer einen gewissen Bestand an Pfeifen sein eigen
nennt und diesen in „glänzendem“ Zustand erhalten
möchte, kommt also früher oder später nicht an der
Anschaffung einer Poliermaschine vorbei. |
 |
Für den Anfang reicht aber auch zum Beispiel
das Hobby-Set von DanPipe bestehend aus einem Vorsatz für die
Bohrmaschine und zwei verschiedenen Wachsen (links im Bild) |
 |
Zuerst wird ein weißes Vorpolierwachs auf
die laufende Scheibe aufgetragen und mit dieser dann die Pfeife
poliert. Beim gesamten Poliervorgang ist es wichtig, das Mundstück
nicht vom Kopf zu trennen. Auf Dauer könnte sonst der Übergang
der beiden Teilen darunter leiden (gebrochene Kanten). Mit einer
sauberen Scheibe oder einem weichen Lappen wird nachpoliert um eventuelle
Wachsrückstände oder Staub zu entfernen. |
 |
Zum Schluß erfolgt die Hochglanzpolitur
mit Carnaubawachs (Wachs der südamerikanischen Carnauba-Palme,
auch Palmwachs). Wichtig erscheint mir, dass für jedes der
Wachse eine Polierscheibe reserviert wird, damit nicht etwa Schleifpartikel
vom Vorpolierwachs mit der Hochglanzpolitur in Verbindung kommen,
das die Scheiben nicht zu schnell (etwa 1500 Upm) laufen und kein
großer Druck ausgeübt wird. |

|
Und ganz wichtig: die Pfeife gut festhalten, den
Zeigefinger im Kopf. Es sind schon einige schöne Stücke
an der gegenüberliegenden Wand demoliert worden. |
| |
|
Aufarbeitung des Ebonit-Mundstücks
Acrylmundstücke sind zwar im Laufe der Jahre immer besser und
angenehmer geworden, die Bißfreundlichkeit und Verarbeitungsmöglichkeit
von Ebonit- oder Parakautschuk-Mundstücken ist allerdings unübertroffen. |
| |
|
 |
Der Nachteil dieses Materials liegt in der fehlenden
Lichtbeständigkeit. Mit der Zeit bekommen sie je nach Schwefelgehalt
einen grauen, braunen oder grünlichen Belag und schmecken auch
entsprechend. Doch auch hier lässt sich mit etwas persönlichem
Einsatz Abhilfe schaffen. |
 |
Da auch hier wieder das Mundstück an der
Pfeife bleiben sollte, wird deren Holm zuerst exakt am Ende mit
Tesafilm abgeklebt, damit die Farbe nicht angegriffen werden kann.
Das Mundstück wird nun nass mit 400er Schleifpapier bearbeitet
bis keine verfärbten Stellen mehr zu sehen sind. Anschließend kommt 1000er Papier zum Einsatz um wieder eine glatte Oberfläche zu erhalten. Wichtig ist auch hier wieder, keine bestehenden Kanten zu brechen. Steg und Sattel sind mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Hilfreich ist hier, das Schleifpapier um einen der Wölbung oder der Kante angepassten Gegenstand zu wickeln. |
 |
Bei dieser Gelegenheit lassen sich auch eventuelle Bißspuren
beseitigen. Nach dem Trocknen haben wir ein grau-mattes Mundstück
vor uns liegen und können mit dem Polieren beginnen. |
 |
Um den ursprünglichen Glanz wieder herzustellen,
ist eine möglichst glatte Oberfläche erforderlich. Deshalb
polieren wir zuerst mit einem braunen Wachs, das feine Schleifkörper
enthält. Hat man die Arbeit mit dem 1000er Papier gewissenhaft ausgeführt, kann dieser Schritt eventuell übergangen werden. |

|
Anschließend verfahren wir wie im Absatz
„Die Maschinenpolitur“ beschrieben, entfernen das Klebeband,
polieren noch einmal über die gesamte Pfeife und können
uns zufrieden zurücklehnen. |
| |
|
Neutralisieren des Geschmacks
Wenn eine Pfeife anfängt bitter zu schmecken oder sie das Aroma
eines Tabaks angenommen hat, den man nicht mehr in ihr rauchen möchte,
ist auch mit einer längeren Ruhepause kein Erfolg zu erzielen.
Sie muß neutralisiert werden. |
| |
|
 |
Zu diesem Zweck wird das Mundstück vom Holm
getrennt, der Kopf gereamt (siehe oben) und mit handelsüblichem
Speisesalz bis kurz unter der Oberkante gefüllt. In das Salz
gibt man einige Tropfen reinen Alkohol aus der Apotheke und stellt
die Pfeife über Nacht aufrecht an einen sicheren Ort. |
 |
Nach ein bis zwei Tagen sieht man das Ergebnis:
Der Alkohol hat eine Menge an braunen Stoffen gelöst, die jetzt
im Salz gebunden sind. Das eventuell hart gewordene Salz wird vorsichtig
und gewissenhaft entfernt und der Pfeife noch ein bis Tage Ruhe
zum Auslüften gegönnt. Eventuell muß der Vorgang
wiederholt werden um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Danach sollte
sie eigentlich wieder wie neu schmecken. |
| |
|
| Hier endet meine Übersicht der einzelnen
Reinigungs- und Pflegeverfahren. Abschließend möchte
ich sagen, das ich all die einzelnen Punkte dieses Artikels nicht
als lästige Pflicht, sondern als Teil meines Hobbies rund
um das Thema Pfeife sehe. Einer Pfeife zu einem gepflegten Äußeren
zu verhelfen, macht mir ähnlich viel Spaß wie der Kauf
einer neuen. Naja, nicht ganz so viel :-)
Spezielle Fragen können gerne in unserem Forum geklärt
werden. |